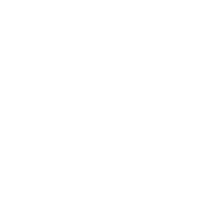Bild Legende:
«Die Waldbewirtschaftung unterstützt den Wald darin, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen», sagt Harald Bugmann.
Grössere Öffnungen würden das Waldklima negativ beeinflussen, es werde wärmer und trockener. Ist da etwas dran?
Mit mehr Licht kommt auch Wärme. Das Mikroklima im Wald verändert sich und wird ähnlich wie im Freiland. Die Vielfalt an bestimmten Arten wie Vögeln oder Schmetterlingen nimmt zu. Nach fünf bis zehn Jahren haben die nachwachsenden Bäume das Waldklima aber weitgehend wieder hergestellt.
Werden Bäume geerntet, trifft mehr Regenwasser auf den Boden und die Verdunstung durch die verbleibenden Bäume geht zurück. Auf einer grösseren Öffnung sind die Böden im Vergleich trockener, da mehr Sonnenlicht auftrifft. Macht der Förster oder die Försterin die Arbeit gut, beziehungsweise ist der Eingriff mit Bedacht ausgeführt, so werden die nachkommenden Bäume aber schon bald Schatten spenden und der Wasserhaushalt pendelt sich wieder ein.
Der Forstbetrieb setzt für Waldarbeiten oft schwere Maschinen ein - aus Effizienz- und Sicherheitsgründen und zur Schonung des verbleibenden Baumbestands. Stimmt es, dass diese den Waldboden zerstören?
Beim Einsatz von schwerem Gerät ist es zentral, dass der Waldboden nur stellenweise und bei möglichst trockener Witterung oder im gefrorenen Zustand befahren wird. Der Forstbetrieb arbeitet mit so genannten Rückegassen, die dauerhaft angelegt sind. Das heisst, der Anteil an befahrenem Waldboden ist gering. Mit einem Astteppich auf den Rückegassen wird der mechanische Druck zusätzlich abgefedert. Wenn schweres Gerät fachmännisch und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt wird, verdichtet das zwar den Boden in den Rückegassen, aber nur punktuell. Wenn es so schonungsvoll gemacht wird wie hier, würde ich bezweifeln, dass das Pilzgeflecht unter der Rückegasse «abgewürgt» wird. Mir sind auch keine wissenschaftlichen Studien bekannt, in denen das nachgewiesen worden wäre. Die Forstwarte und Försterinnen in der Schweiz sind sehr gut ausgebildet. Sie wissen, was sie tun, wie wichtig ein gesunder Waldboden ist und wie sie ihn erhalten. Ich habe auf dem Rundgang in etliche Rückegassen hineingeschaut: Hier wird schonend gearbeitet.
Wird durch die Waldbewirtschaftung der Lebensraum von Tieren und Pflanzen beeinträchtigt?
Verschiedene Arten profitieren von der Waldbewirtschaftung – vor allem diejenigen, die auf Licht und Wärme angewiesen sind. Lichte Wälder werden deshalb als Biodiversitätsmassnahme durch Bundesbeiträge gefördert. Ohne Bewirtschaftung verschwinden sie. Andere Arten sind jedoch auf Schatten, alte Bäume und Totholz angewiesen. Bedingungen, wie sie vor allem in Waldreservaten anzutreffen sind. Artenreichtum braucht vielfältige und abwechslungsreiche Lebensräume, die untereinander vernetzt sind.
Waldbesuchende stören sich teilweise an Brombeere, Brennnessel oder invasiven Neophyten. Sind diese Pflanzen ein Problem?
Wir haben im Wald ein Problem mit zu hohen Stickstoffeinträgen aus Verkehr oder Landwirtschaft. Das begünstigt das Wachstum von bestimmten Pflanzen bei günstigen Lichtverhältnissen. Es kann insofern zum Problem werden, wenn sie nach einem waldbaulichen Eingriff durch ihr starkes Wachstum das Aufkommen von Jungbäumchen behindern. In diesem Fall muss die Konkurrenzvegetation gemäht werden, bis die Bäumchen gross genug sind und Schatten spenden. Dann gehen die lichtbedürftigen Pflanzen von selbst wieder zurück. Dieser Prozess braucht 20 bis 30 Jahre. Langfristig setzt sich immer eine Baumgeneration durch. Leider gibt es keine effiziente Lösung, um den Stickstoffüberschuss im Waldboden zu reduzieren.